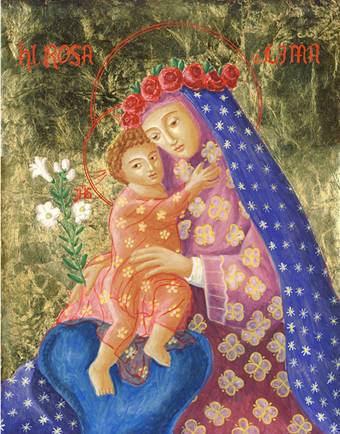|
Ikonen |
|
|
||||||
|
Christus, der Herr der Welt
(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXXI) Während der Karwoche 2022
hörte ich die Nachrichten zum Ukrainekrieg und erinnerte mich an das
Evangelium, wonach unter den Jüngern während des Abendmahls ein Streit
entbrennt, wer unter ihnen der Größte sei (Lk
22,24). Das bewog mich, Christus in Gestalt des „ecce
homo“ darzustellen, angetan mit Purpurmantel, Dornenkrone und Binsenzweig,
denn Markus stellt in der Verspottung Jesu die wahren Machtverhältnisse dar:
Jesus ist tatsächlich der Kaiser, dem die Soldaten huldigen. Entsprechend tritt
er hier auch herrscherlich auf, er setzt seine Füße auf die Erde, die in der
Tat sein Eigentum ist, für die er aber auch eintritt. Zu Füßen liegen ihm
auch die habsburgische Rudolfskrone und die russische
Paulskrone, Symbole für das westliche und das
östliche Kaisertum, beide auf einer Blumenwiese, die an 1 Petr 1,24 erinnert:
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und des Menschen Herrlichkeit wie des
Grases Blume. Der Ehrgeiz einer Bande von alten Männern, die darum streiten,
wer unter ihnen der Größte sei, steht auf dem Kreuz, denn das ist auch im
Jahre 2022 die Ursünde des Menschen. Umgeben wird Christus im Rahmen von
Waffen und Bomben, die im Kontrast dazu stehen, dass sich alle Beteiligten an
diesem Konflikt „Christen“ nennen. 2022 in München. Aquarell,
24 x 32 cm. |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Der Herr der Jahrtausende
(Ikonenverzeichnis-Nr.: XLII) Im Milenniumsjahr
hatte ich den Gedanken, Jesus als Herrscher über die Äonen darzustellen. Er
steht auf einer Sphaira/Erdkugel und ist als
jüdischer Rabbi gekleidet. Die christlichen Jahrtausende sind durch
Personifizierungen dargestellt. Das erste Jahrtausend ist im Stil der Antike
gekleidet und hält ein römisches Wachstäfelchen mit Griffel in der Hand.
Darauf steht die römische Ziffer I. Die Figur des zweiten Jahrtausends ist
Kaiserin Maria, der Frau Kaiser Karls V. nachempfunden, wie Tizian sie malte.
Der Pergamentbogen, den sie zusammen mit einer Gänsefeder hält, trägt die
arabische Ziffer 2. Das Baby in Jesu Arm ist in einen modernen Strampler mit
Schnuller gekleidet. Es hält ein Notebook auf dem in elektronischer Form die
Zahl 3 zu sehen ist und steht für das eben angebrochene dritte christliche
Jahrtausend. Jesus ist von einer leuchtende Sphaira
umgeben, aus der vier rote und drei grüne Spiralen
hervortreten. Sie stehen für die Dreifaltigkeit und die vier Evangelien. Außen
herum reiht sich der Tierkreis in realistischen Sternkonstellationen auf, der
für die Weltordnung und die Ewigkeit steht, genauso wie die Arkathusranken in die vier Ecken der Ikone. Der gebogene
Schriftzug ist ein Pendent zum Zoodiakos. 2000 in München.
Eitempera auf Holz, 25
x 32 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
20 Jahre Opus Montanorum (Ikonenverzeichnis-Nr.: LXVII) 1989 war ich erstmals mit
einer unter der Leitung von 2009 in München.
Eitempera auf Holz, 32
x 25 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
Die Freude am Herrn
(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXIX) Als der damalige Pfarrer
von St. Ulrich in München-Laim verabschiedet wurde, schenkte ihm die Pfarrei
ein Buch aus von verschiedenen Gruppen gestalteten Seiten. Die Damen vom
Pfarrbüro baten mich um ein Bild dafür. Da Pfarrer 2011 in München.
Aquarell, 20 x
22 cm. |
||||||
|
|
|
|||||
|
Der heilige Nikolaus
(Ikonenverzeichnis-Nr.: LVII) Dieses Bild entstand im
November 2006 als Vorlage für ein meditatives Ikonenmalen, das ich bis 2012 in
der Pfarrei St. Ulrich anbot. Es folgt dem Vorbild, das ich zunächst 1985 als
Weihnachtsgeschenk für meine damalige verehrte Kommilitonin Marion Zwerger
malte (Ikonenverzeichnis IV) und der Kopie, die ich im Sommer 1987 im Kloster
Niederaltailch anfertigte (Ikonenverzeichnis V –
beide siehe unten). Der Neuentwurf ist
einfacher gestaltet als die Vorlagen und musste wegen des Termindrucks zur
Ikonenmeditation schneller fertigwerden. Sie ist aber auch freundlicher und
heller von den Farben. Während ich die beiden Vorgänger nach der Tradition
malte, vom Dunkel ins Licht zu arbeiten, wandte ich hier meine inzwischen
übliche Vorgehensweise an, von einem Mittelton her in die Schatten und ins
Licht zu arbeiten. 2006 in München.
Eitempera auf Holz, 25
x 32 cm. |
||||||
|
|
|
|||||
|
Die Muttergottes aus der
Hagia Sophia (Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXIV) Während meiner Promotion
besuchte ich Vorlesungen und Seminare im Fach Byzantinistik. Dabei wurde ich
auf das freigelegte Apsismosaik der Hagia Sophia in
Konstantinopel (Istanbul) aufmerksam. Anhand eines Schwarzweißfotos entwarf
ich 1996 die erste Ikone dazu (Ikonenverzeichnis XXIII – siehe unten). Die
Farbgebung und den Faltenwurf wählte ich so, wie ich aus der Vorlage es zu
erschließen meinte. Als Rahmen wählte ich ein Muster aus dem Grabmal der
Galla Placidia in Ravenna. Schon damals faszinierte
mich das Bild wegen seiner vornehmen Eleganz. 2014 verwirklichte ich mein
langjähriges Vorhaben, die Ikone neu zu malen. Besseres Bildmaterial erlaubte
mir nun eine exaktere Wiedergabe des Originals aus der Zeit Kaiser Basileios’
I. um 867/70. Der Rahmen folgt nun der Ornamentik, wie sie in der Hagia
Sophia heute zu finden ist und ist auf den Goldgrund aufgemalt. Auch hier ist
es mir glücklicherweise gelungen, die vornehme Eleganz der Maria und des
Jesuskindes wiederzugeben. 2014 in München.
Eitempera auf Holz, 25
x 32 cm. |
||||||
|
|
|
|||||
|
Die Schöpfung
(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXVI) Die ist meine dritte Ikone,
die sich mit dem Schöpfungsthema beschäftigt. Sie ist aus den Motiven der
Vorgängerbilder zusammengefügt. Christus, der die Welt mit einem Zirkel
konstruiert, ist in mittelalterlichen Miniaturen belegt. In meinem Fall
besteht der Zirkel aus dem griechischen Wort enhqhto (es
werde), mit dem Gott das Licht schafft (und mit dem Christus, das Wort
Gottes, in die Welt tritt). Der rote Rand, der die Welt mit Sonne, Mond,
Pflanzen, Meer, Himmel, Schaf, Fisch und Menschenpaar umrahmt, ist dem Uterus
nachempfunden und auch so in Miniaturen schon belegt. Über ihr schwebt eine
Taube, der Geist Gottes. Christus selbst ist golden:
das ist die Farbe Gottes. Er steht oder schwebt in einem großen Farbkreis,
der in der Finsternis aufscheint. Die weiße Spirale steht für die über sich
hinausweisende Dynamik, mit der Gottes Geist die Welt ins Werk setzt. 2014 in München.
Eitempera auf Holz, 25
x 32 cm. Die beiden Vorgängerbilder:
Genesis (LXIII) 2008 und Das
Hervortreten des Logos im Urknall (LXX) 2012 Beide Eitempera auf Holz, 25 x 32 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
Die heilige
Dreifaltigkeit nach Rubljew (Ikonenverzeichnis-Nr.:
LXXI) Erst mit meiner 71. Ikone wagte
ich mich an die berühmte Ikone des Malermönchs Andrej Rubljew.
Beim Bild gestaltete ich im Verhältnis 1:3 des großen Originals. Vom Motiv
hielt ich mich so genau an die Vorlage wie es mir aufgrund der Vorlagen
möglich war. Ein bedeutender Unterschied ist allerdings die Technik der
Gewänder. Wie auf vielen anderen Ikonen bereits baute ich die Farben nicht
vom Dunkel zum Licht auf, sondern grundierte die weiß und arbeitete die
Plastizität wie beim Aquarell ins Dunkel hinein. Auf diese Weise erhalten sie
ein Licht, das im Gegensatz zum Umfeld von innen heraus zu kommen scheint. Das Motiv folgt der
Erzählung vom Besuch der drei Männer bei Abraham bei den Eichen von Mamre (Gen 18). Die Männer verheißen Abraham und Sarah
die wunderbare Geburt ihres Sohnes Isaak. Schon der Bibeltext lässt erkennen,
dass durch die Männer Gott zu erkennen ist. Darum wurde das Motiv zur Chiffre
für den dreifaltigen Gott. Die mittlere Figur folgt in ihrer Gewandung der
Christus-Darstellung. Da Grün im alten Ägypten und der Metaphorik der
römisch-hellenistischen Welt die Farbe des Geistes ist, dürfen wir in der
rechten Figur den Heiligen Geist erkennen. Da sich beide zur linken Figur
hinwenden, ist in ihr wohl der Vater zu sehen. Übrigens war rosa bis ca. 1800
die klassische Männerfarbe. Auf dem Tisch steht ein Kelch; die Eucharistie
verbindet Gott mit den gläubigen Menschen. 2012 in München.
Eitempera auf Holz, 40
x 50 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
Rosa von Lima
(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXX) Zur heiligen Erstkommunion
malte ich meiner Tochter eine Ikone ihrer Namenspatronin Rosa von Lima
(eigentlich: Isabella Flores, 1586 bis 1617). Das Motiv folgt einem barocken
Vorbild. Rosa ist von Rosen bekränzt
und hält das Jesuskind und eine Lilie. Entgegen meiner Gewohnheit
gestaltete ich die Aufschrift in lateinischer Schrift. 2009 in München.
Eitempera auf Holz, 25
x 32 cm. |
||||||
|
|
|
|||||
|
30 Jahre Apostrōn
Adärät (Ikonenverzeichnis-Nr.: LXV) Mein Werk umfasst neben
klassischen Ikonen auch eine Reihe von Tafelbildern im Ikonenstil. Neben
antiken Motiven zählen dazu einige Jubiläumsbilder. Anlässlich des 20jährigen
Jubiläums meines Romans „Apostrōn Adärät“ malte ich 1998 das unten
abgebildete Tafelbild (Nr. XXIX) zeigt Karodin Tarien und seine Frau
Sakuntala Tagore im Krönigsornat neben Maria mit
dem Jesuskind, beide, wie auch die Lorbeerkränze, nach spätantik-römischen
Vorbildern. Der Adler über der Gruppe folgt spätrömischen Vorbildern, wie sie
etwa im Kaiserkult-Heiligtum in Lukor zu finden
sind. Das Apostrōn-Paar steht römischen Vorbildern auf Kissen – in
diesem Fall auf Galaxien in einem Sternenmeer. Die Säulen sind ionisch, der
Bogen folgt indischen Vorbildern. Zum 30. Jubiläum 2008 malte
ich ein neues Bild. Nun steht Karodin Tarien zusammen mit seiner Frau und
seinen fünf Kindern vor einem Bildschirm, der den Blick in dem Weltraum
zeigt. Über Chōra Myriōn schwebt ein Raumkreuzer, von dem gerade
eine Tori-Fähre startet. Im Hintergrund sind eine Raumstation und die Sonne
Deng-gadol zu sehen. Das Familienporträt folgt
verschiedenen klassischen Bildern, die hier zusammenkomponiert und der neuen
Situation angeglichen wurden. Beide Bilder stelle ich vor
anlässlich des Erscheinens von Band 1 des „Apostrōn Adärät“ im Verlag
united p.c. am 17. Juli 2014. 2008 in München.
Eitempera auf Holz, 40
x 50 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
1250 Jahre Kloster
Tegernsee C (Ikonenverzeichnis-Nr.: XXI) Zum Jubiläum der Klostergründung
malte ich eine Ikone, die die alten und neuen Patrone der Kirche zeigt: Im Zentrum steht der
heilige Quirinus im Purpurmantel, der bekannten Darstellung Kaiser Justinians
in Ravenna folgend. Er hält eine Modell der
Klosterkirche und den Abtsstab von Quirin Rest (16.
Jh.) in Händen. Zu seinen Seiten stehen der heilige Chroyogonus
und der heilige Kastorius, die beiden anderen
Patrone der Kirche. Beide halten Ikonen von
Petrus und Paulus in Händen. Den beiden Apostelfürsten war die Kirche vor Eintreffen
der Quirinus-Reliquien geweiht. Beide sind auch heute noch durch große
Figuren auf dem Hauptaltar vertreten. Das ursprüngliche Kloster
hatte den Salvator, Gott als Retter zum Patron. Darauf verweist die
Trinitätsdarstellung über den Heiligen. Sie folgt der Darstellung im Scheitel
der Kuppel in der Vierung der Kirche. Zu Füßen der Heiligen ist
das Klosterwappen zu sehen. Das Bild wird von einer goldenen Akanthusranke
umgeben. Sie steht für die Ewigkeit. 1996 in München. Eitempera
auf Holz, 25 x 32 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
Quirinus von Tegernsee C
(Ikonenverzeichnis-Nr.: XV) Angeregt von einer
Darstellung des heiligen Willibrord als Ikone in einem Heft „der Christliche
Osten“ kam ich um 1990 auf den Gedanken, von den traditionellen Ikonenmotiven
abzugehen und eigene Bilder zu entwerfen. Die erste Ikone dieser Art
zeigte den heiligen Quirinus von Tegernsee (A, Nr. VII 1990 – unten links).
Die Haltung folgt einer Vorlage des Erzengels Rafael von Karl Berger, die
Bekleidung als römischer Kaiser und die Märtyrer-Attribute Schwert und Paslme der Darstellung im Nartex
der Tegernseer Klosterkirche. Er steht in einer Landschaft, die das Kloster
links und den Wallberg rechts zeigt. Im Rahmen meiner neuen Ikonenwand (vgl.
Kosmokrator C) malte ich den Quirinus passend zu den anderen Ikonen 1993 neu
(B, Nr. XIII, rechts unten). Nun sind zu seinen Füßen die Symbole der ihm
zugeschriebenen vier Wunder: Feuer: als die Leute während des Transports des Sarkophages von Rom nach Tegernsee zweifelten, ob auch
die echten Reliquien darin seinen, wollten sie den
Sarkophag öffnen, woraufhin ihnen Feuer entgegenschlug. Wasser: An der Stelle, an der der Sarkophag das letzte Mal
abgestellt wurde, ehe er in das Kloster eingeholt wurde, entsprang die
Heilquelle von Sankt Quirin. Fleisch: Bei der Umbettung der Reliquien in die barocke
Klosterkirche soll der Sarkophag zu Boden gefallen sein. Dabei kam frisches
Fleisch zum Vorschein. Öl: Am Westufer des Sees wurde das heilbringende
Quirinus-Öl entdeckt. Nach ihm suchten in den 1920er Jahren jene
Niederländer, die dann auf die weltberühmte Jod-Schwefel-Quelle von Bad
Wiessee stießen – des Quirinus 2. Wasser-Wunder! Statt des Wallbergs ist nun
der Tiber zu sehen mit der Kirche St. Chrysogono
(die ich 1991 fälschlicherweise für eine Quirinus-Kirche hielt). Zu beiden
Seiten über den Namenskartuschen sind die Wappen von Rom und Tegernsee zu
sehen. Die dritte Ikone malte ich
1994 als Votivbild zum Dank einer erfolgreichen Diplomprüfung, die mich zur
Promotion befähigte. Sie wurde im Dezember 1996 dem Abt Emmanuel Jungklausen
von Niederaltaich übergeben. 1994 in Rottach-Egern.
Eitempera auf Holz, 25 x 32 cm. |
||||||
|
|
|
|||||
|
Erzengel Michael C(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXI) Meine erste Ikone, die ich während
der Weihnachtsferien 1983/84 zusammen mit meiner Mutter malte, war der
Erzengel Michael in der Rüstung eines römisch-byzantinischen Kriegers, mit
Heeresmantel und Schwert (siehe unten links; Ikonenverzeichnis I). Das
Inkarnat vervollständigte ich 1990, ohne jedoch die alte Vorlage verwenden zu
können. 1999 fertigte ich den
Erzengel dann für eine Studienkollegin meiner Frau (Ikonenverzeichnis XXXIV)
und kurz darauf auch für mich selbst an (unten Mitte; Ikonenverzeichnis
XXXVI). Hierbei malte ich von vorn herein heller und arbeitete nicht mehr wie
beim Michael A vom dunkelsten Ton ins Helle hinein – was durchaus eine
sinnfällige Symbolik besitzt: Die Ikone kommt vom Dunkel zum Licht. 2002 schuf ich als
Gegenstück mit der gleichen Vorlage den Erzengel Gabriel (unten rechts;
Ikonenverzeichnis XLIX). Die Farbgebung Hellblau-Ochergelb-Rot
wurde hier variiert. Im Raum steht noch eine Muttergottesikone gleichen Stils
als Mittelstück. Da ich den Michael B zur
Firmung verschenkte, wurde 2012 eine Neufassung für mich notwendig. Das Schwert, das Michael
nun hält, folgt dem Typ 2 des „Fosforos“ aus dem Iraklonas. Die Parierstange soll die Mondsichel darstellen, über der –
freilich auf der „falschen“ Seite der Morgenstern im Knauf strahlt. 2012 in München. Eitempera
auf Holz, 25 x 32 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
Christus Kosmokrator D
(Ikonenverzeichnis-Nr.: XLVI) 2001 malte ich meine
„Altarikonen“ neu. Damit verbunden war die Idee, auf den Seitenikonen die Namenspatronen von mir und meiner Frau wiederzugeben
(2003 erweitert um die Namenspatroner unserer
Tochter). Bei dieser Gelegenheit konzipierte ich auch die Mittelikone neu: Geblieben sind im Vergleich
zum Konsmokrator C die kreisförmige Mandorla, die
Beischriften Christi, die beiden Keruben als Thron Christi, die Beiden Serafen nach Jes 6, die
Evangelistensymbole mit den bekannten Zitaten aus ihren Schriften, die
Darstellungen der Schöpfung (oben) und der Passionswoche (unten), die zwei
Heiligen zur Seite Jesu mit Namenskartuschen und die Formensprache des
Rahmens, der jener der Tegernseer Klosterkirche folgt. Neu ist die Gestaltung der Marndorla als Regenbogen. Diese Darstellung richtet sich
nach einer ganz ähnlichen Mandorla in der Klosterkirche von Daphni/Griechenland. Christus wird nun (und von hier an
immer) in einer neuen Technik gemalt: nicht mehr Auftrag der dunkelsten Farbe
und schrittweise Aufhellung, sondern Grundauftrag weiß und Modellierung durch
immer dunklere Farben. Dadurch leuchtet Christus aus dem Bild heraus und hebt
sich in göttlichem Licht von seiner Umgebung ab. Die zwei Serafen wandern wieder wie beim Kosmokrator B in den
Rahmen und macht den Evangelisten ihre angestammten Plätze frei – allerdings
jetzt im Gold schwebend. Die Zwickel werden nur noch durch die Stellung der
Flügel angedeutet. Die beiden Keruben werden unten sehr dunkel und nach oben
hin heller dargestellt – sie deuten Gewitterwolken an. Jesus zur Seite stehen
nun Maria und Quirin von Tegernsee, Beide in kaiserlichen Purpur gehüllt. Die
Kinder, die sie tragen, stellen meine Frau und mich dar. 2001 in München.
Eitempera auf Holz, 40 x 50 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
Christus Kosmokrator C
(Ikonenverzeichnis-Nr.: X) Den Kosmokrator B hatte ich
1990 mit den schon früher entstandenen Ikonen des Erzengels Michael und des
Heiligen Nikolaus zu einem Triptychon als Hausaltar verbunden. 1991 kam noch
der Heilige Quirinus von Tegernsee dazu. 1994 gestaltete ich dieses „Tetraptychon“ durch eigens dafür gemalte Ikonen neu. Die
Zentralikone versteht sich als Weiterentwicklung des Kosmokrator B. Geblieben sind die kreisförmige Mandorla mit dem Davidsstern. Die
naturgetreuen Darstellungen des Tierkreises werden nun in den Stern
eingefügt. Auch die Zeugnisse der vier Evangelien blieben und stehen nun in
Gold auf dem äußeren Kreis der Sphaira (die keine
mandelförmige Mandorla mehr ist). Aus den vier Wochenbändern bleiben zwei:
oben die Schöpfung, unten die Passionswoche; beide nun in je drei Kartuschen
untergebracht. Und die vier Bundeszeichen (der Regenbogen des Noah, die
Bundeslade des Mose, der Heilige Geist als
Feuerzungen (Pfingsten) und als Taube) bleiben in den Ecken. Auch jetzt steht
im Buch das Vaterunser in Hebräisch und griechisch zu lesen. Neu ist insgesamt die
Formensprache, die der Klosterkirche Tegernsee folgt. Vier Serafen wandern in die Zwickel, die Evangelistensymbole
erscheinen nun in je zwei Kartuschen im Rahmen. Christus thront nun über zwei
Keruben, die als blaue, gefügelte Löwen dargestellt
werden. Ihm zur Seite stehen Mose und Elia. Das Bild, das die Passionswoche
zum Ostersonntag hin fortführt wird so auch zu einer Verklärungsdarstellung.
Christus streckt seine Segenshand seitwärts aus, damit der Gestus als
Parallele zur Segenshand der monumentalen Konstantins-Statue in Rom sichtbar
wird. Über und unter dem Zentralmotiv steht in hebräisch
und griechisch: „Jesus Christus der Allherrscher“. 1994 in Rottach-Egern.
Eitempera auf Holz, 40 x 50 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
Christus Kosmokrator B
(Ikonenverzeichnis-Nr.: VI) Die Ikone wurde nach dem
Vorbild des Kosmokrator A von 1983 neu geschaffen. Nach einem Vorbild aus dem
Fernsehen gestaltete ich die Mandorla jetzt kreisförmig, mit einem Davidstern
unterlegt. Christus sitzt über Keruben, die die Insignien des östlichen
(russischen) und westlichen (römisch-deutschen) Kaisertums. Zwei sechsflüglige
Serafen stehen hinter ihm vor einem Tierkreis aus
tatsächlichen Sternenkonstellationen. Zu seinen Füßen ist die Bundeslade. In den Zwickeln stehen die
vier Evangelistensymbole: Engel (Matthäus), Adler (Johannes), Löwe (Markus)
und Stier (Lukas). Sie halten Schriftrollen mit Christusbekenntnissen aus den
Evangelien in deutscher, griechischer, hebräischer und lateinischer Sprache. Das Buch in Christi Hand
nennt die ersten Bitten des Vater unser in hebräisch und griechisch. Rings um die Darstellung
laufen vier Bänder, die (im Uhrzeigersinn)die
Schöpfung, die Passion, die Visionen der Sieben Siegel und das mutmaßliche
jüdische Bundesfest darstellen. In den Ecken werden vier Bundeszeichen
dargestellt: den Regenbogen des Noah, Die Bundeslade des
Mose, der Heilige Geist als Feuerzungen (Pfingsten) und als Taube. 1990 in Rottach-Egern.
Eitempera auf Holz, 40 x 50 cm. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Christus Kosmokrator A
(Ikonenverzeichnis-Nr.: II) Christus sitzt auf einem
nur schemenhaft abgehobenen Thron. Sechsflüglige Serafen
umstehen ihn vor einem Sternenhimmel. Zu seinen Füßen sind Ophanim (Räder), wie sie aus der Thron-Vision von Ez 1 bekannt sind. In den Zwickeln stehen die
vier Tiere (aus Ez 1), die sich in der christlichen
Theologie als Symbole für die Evangelisten eingebürgert haben: Engel: Matthäus, Adler:
Johannes, Löwe: Markus und Stier: Lukas. Der wie zur Verklärung ganz
weiß gekleidete Christus hält ein Buch in der Hand. Darauf steht in
kyrillischen Buchstaben der deutsche Text: Was ihr den geringsten meiner
Brüder tut, das tut ihr mir. 1983 in Niederaltaich. Das Gesicht von Prof. Karl Berger. Eitempera auf Holz, 25 x
32 cm. |
||||||